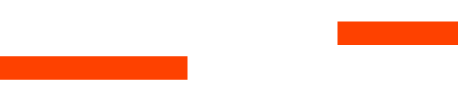Anna Mikhajlova
Die ersten Wochen der Blockade:
September – Oktober 1941
Die Blockade… Wir hatten es nicht geschafft, die Stadt zu verlassen, um in die Evakuierung zu gehen.1 Der Blockadering war bereits geschlossen. Und wir – ich, meine Mutter, mein Vater, mein Bruder und das Kindermädchen – befanden uns in der Blockade.
Die ersten Monate, September und Oktober, wurde Leningrad sehr stark bombardiert. Vor allem die Druckerei2 war ein Ziel. Auch die umliegenden Häuser litten unter Bombardierungen. Die Menschen waren sehr hilfsbereit. Ich möchte ein Beispiel geben. Während der Bombardierungen mussten wir in den Luftschutzkeller gehen.3 Der Luftschutzkeller befand sich auf der anderen Seite des Hauses, in einem anderen Haus, und meine Mutter legte uns Kissen auf den Kopf, damit uns die Glassplitter nicht verletzten. So mussten wir also immer hinlaufen.

Wir wohnten im vierten Stock, und es war sehr, na ja, es war umständlich. Und eine Frau mit zwei Kindern, die zwei Zimmer in einer Erdgeschosswohnung hatte, bot meiner Mutter an, bei ihr zu wohnen. Ich meine, damit man nicht aus dem vierten Stock fliehen muss, sondern aus dem Erdgeschoss. Das zeugt doch irgendwie von Empathie und von der Freundschaft der Mieter untereinander. Aber dann wurde das Laufen zum Luftschutzkeller mühsam, wir hörten auf zu laufen. Wir saßen während der Bombardierung zu Hause.
Ich beendete also drei Klassen vor dem Krieg, die vierte – sie hätte im September 1941 begonnen – habe ich nicht besucht… Da bin ich nicht in die Schule gegangen.
Ich war im Krankenhaus, weil ich sehr starkes Rheuma mit Schwellungen hatte. Ich war vier Monate lang im Krankenhaus. Im Krankenhaus wurde ich zumindest etwas mit Essen versorgt, obwohl einige auch dort an Hunger starben. Ich habe damals gedacht, ich werde es nicht überleben… Also dachte ich, na ja, ich sterbe morgen, kann man nichts machen? Es gab also überhaupt keine Angst. Denn es waren ja solche Skelette um mich herum.4
Allgegenwärtigkeit des Todes
Am 12. Dezember 1941 starb mein Vater am Hunger. Zu dieser Zeit war das Kindermädchen bereits gestorben und die beiden Deutschen5, die Besitzer dieser Wohnung, waren gestorben. Die Hungersnot war also schon sehr groß. Mein Vater starb am 12. Dezember und lag etwa zehn Tage lang in der Küche auf dem Herd. Ich hatte kein Mitgefühl, keine Trauer, keine Angst – es gab nichts, keine Emotionen, – das Hungergefühl überwältigte alles. Ich bin also in der Küche herumgelaufen und hatte keine Gefühle für meinen toten Vater, der dort lag. Obwohl ich elf Jahre alt war, und man kann Angst haben und trauern… Es wäre richtig, Gefühle zu haben. Aber es gab keine.
Aber ich habe überlebt. Meine Mama hatte es geschafft, meinen Bruder in ein Waisenhaus zu bringen. Warum in ein Waisenhaus? Weil es zwei Kinder waren, und sie war allein, mein Vater war schon tot. Sie hätte es allein nicht geschafft, und im Waisenhaus gab es noch ein bisschen was zu essen, immerhin etwas zu essen. Und in den Schulen gab es dasselbe – sie gaben ein bisschen flüssige Suppe oder sehr dünnen Brei, ein bisschen, und normalerweise wurde dieses Mittagessen in einem Köfferchen nach Hause getragen. Ich erinnere mich, dass ich diese Suppen immer in der Tabaktasche meines Vaters mitgenommen habe. Einmal wurde sie mir geklaut, aus der Hand gerissen, und ich dachte, das wär’s mit mir.
Wie ist es gelungen, am Leben zu bleiben?
Ich glaube, es ist Mamas, Mamas Arbeit [wodurch wir überlebt haben]. Aber auch von meinem Vater. Mein Vater hat die Burzhujka gebaut. Wisst ihr, was eine Burzhujka ist? Das ist ein Herd, ein Herd im Zimmer, und weil es kein Holz gab, haben wir mit Möbeln geheizt. Und dann… meine Mama bekam seit Beginn der Blockade ihre Lebensmittel auf eine Angestelltenkarte6… Um eine Arbeiterkarte zu bekommen, erlernte sie Autofahren, bekam einen Führerschein und begann als Chauffeurin zu arbeiten. Als Chauffeurin zu arbeiten bedeutet, ausgebildet zu werden und fahren zu können, auch Verantwortung, aber trotzdem machte meine Mama dies, um eine Arbeiterkarte zu bekommen. Sie hat also um unser Leben gekämpft, wie soll man sagen? Denn mit einer Arbeiterkarte bekam man jeden Tag 250 Gramm Brot, mit einer Angestelltenkarte 125 Gramm.
Und die Tatsache, dass sie meinen Bruder in ein Waisenhaus gesteckt hat, die Tatsache, dass ich im Krankenhaus war – all das rettete uns. Mama hat einen Gemüsegarten angelegt, sie bekam ein Stück Land am Stadion für das Gemüsebeet zugewiesen.7 Sie pflanzte Rüben an, eine Art Gemüse. Das meiste von der Ernte haben sie jedoch gestohlen, aber wenigstens ist uns Kraut geblieben und wir haben ein bisschen was bekommen. Wenn man es also so analysiert, ist es ihr Kampf ums Leben. Und der Kampf um unser Leben, mein Leben. Denn mein Vater ist gestorben, mein Kindermädchen ist gestorben.
Und wir hatten eine Hausärztin, auch eine Deutsche. Sie sagte, dass der Wodka, den man an Feiertagen bekommt, auf die Arbeiterkarte, den sollte man nicht gegen Brot tauschen, sondern den Kindern geben – einen Teelöffel. Ich war zehn, mein Bruder war fünf. Ein Teelöffel pro Tag. Das ist sei kalorienreicher und gesünder als Brot, das aus Staub gemacht ist.8
Was ist die Blockade?
Ein schrecklicher Albtraum, den ich durchlebt habe. Und so ein Alptraum, dass… Ich habe noch nie so eine… so eine Angst erlebt…. Denn die Menschen starben auf der Straße, die Menschen starben zu Hause, die Menschen starben überall, und ein Mann lief, lief, fiel in den Schnee, und niemand lief zu ihm und half ihm, sich aufzurichten. Man ging an ihm vorbei, und er erfror. […] Es gab keine Heizung, kein Wasser, kein Radio, keinen Strom, keine Verkehrsmittel. Ich meine, es gab nichts. Die Stadt war gefroren. Es war ein sehr kalter Winter, Dunkelheit, denn man musste sich verkleiden, Vorhänge anziehen, und sie kontrollierten, dass das Fenster nicht beleuchtet war. Es gab kein Wasser, wir haben uns ein ganzes Jahr nicht gewaschen, und das Badehaus wurde erst im Frühjahr [1942] wieder geöffnet, und wir waren alle schwarz. Wir waren alle schwarz, weil wir als Lichtquelle die Kerosin-Dochte benutzten. Es war ein Baumwolldocht, ein Ende wurde in Kerosin getaucht und das andere Ende mit einem Draht umwickelt und angezündet. Denn es gab keine Kerzen, man hat die Kerzen ja aufgegessen. Wir aßen Gürtel, gekochte Lederschuhe, gekochte Lederjacken, wenn jemand welche hatte, Brennnesseln.9 Ich habe immer noch eine Vorliebe für Brennnesseln und Gartenmelde, denn im Sommer aßen wir dieses Grünzeug. Die Melde war sogar… so mehlig. Deshalb habe ich immer noch zarte Gefühle für diese Pflanzen, weil sie einem etwas zu kauen gaben.
Also, es gab kein Licht, kein Wasser, wir hatten alle Läuse. Kopfläuse, Haarläuse und Kleiderläuse. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie meine Mutter im Frühjahr alle Kleider einsammelte, auf dem nackten Boden stapelte, sie mit Stäubemittel übergoss und dort liegen ließ. Und so nach, na ja, nach vierundzwanzig Stunden, wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr, nach einiger Zeit, schüttelte sie sie aus und dieser Regen von Läusen fiel….
Wir hatten nie ein Radio, und während der Blockade erst recht nicht, es gab nur Sirenen, wenn der Alarm und der Beschuss begannen.
Nachträglichkeit der Erinnerung
Das ist mein Umgang mit Essen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Karotte esse und ich kann sie irgendwie nicht kauen oder meine Zähne erlauben es mir nicht, sie zu kauen, aber ich muss mich überwinden, es nicht liegen zu lassen, es zu essen.10 Ich meine, ich meine, ich kann doch jetzt nicht ein Stück Brot wegwerfen. Ich schneide die Krusten ab. Ich habe Brot für eine lange Zeit, ich kaufe es nicht jeden Tag, und die Krusten trocknen ein. Und wenn sie trocken und krümelig oder knusprig sind, esse ich sie.
Einmal ging ich, wahrscheinlich im zweiten Jahr der Blockade, um Duranda11 oder Hafer zu holen. Und gleich in meiner Nähe, nur zwei oder drei Meter entfernt, flog in die Lücke zwischen den Häusern eine Granate hinein.
Bis heute gehe ich diesen Teil des Weges immer noch mit Herzrasen. Das habe ich immer noch. Das heißt, nach dem Krieg, wenn ich gehen musste, versuchte ich, nicht diesen Weg zu gehen, eine andere Strecke zu laufen, weil ich das alte Gefühl hatte, das Gefühl der Blockade…
Gegensatz zur Blockade-Erinnerung
Das hat nichts mit der Blockade zu tun, aber ich erzähle Ihnen mehr aus meiner Biografie. Ich habe mit der Königin von England an einem Tisch gesessen.
… mein Mann war Geologe, und er hatte einen Kollegen, der zum Überwintern in die Antarktis ging, zwei oder drei Mal. Und … und in der Antarktis ist nicht viel los, so dass alle, alle antarktischen Stationen, Polarstationen, miteinander in Kontakt waren. Und unsere war in Kontakt mit den Engländern. Und als die englische Königin in die Antarktis kam, um ihre Polarforscher zu besuchen, waren auch unsere Polarforscher eingeladen. Als die Königin dann in Leningrad in Staatsangelegenheiten zu Besuch war, lud sie die Leningrader Polarforscher in ein Restaurant zu einem Empfang ein. Und ich ging mit dem Kollegen meines Mannes und meinem Freund hin und saß, zwar nicht zu meiner Rechten, sondern irgendwo am Rande des Tisches, aber mit der englischen Königin.12
2. Hier arbeitete Annas Vater, es befand sich im Zentrum Leningrads am Anitschkov-Palast.
3. Nach der Anordnung der Stadtverwaltung hatten Leningrader bei Luftalarm Luftschutzkeller aufzusuchen. Die Häufigkeit und die Dauer der Luftalarme sowie die zunehmende Erschöpfung vor Hunger führten dazu, dass Leningrader aufhörten, in die Keller zu gehen und in ihren Wohnungen blieben. Ihre einzige Sorge war nun: Essen.

5. Anna meint zwei Russlanddeutsche Frauen, die noch seit der vorrevolutionären Zeit in der Stadt wohnten. St. Petersburg (Leningrad) hatte eine große deutsche Gemeinschaft. In den stalinistischen Säuberungen 1937/38 („Großer Terror“) wurde diese zum Ziel der so genannten „nationalen Operationen“, mehrere Tausende wurden angeklagt, verhaftet und hingerichtet. Zu Beginn des Krieges wohnte also eine relativ kleine Anzahl der Deutschen noch in der Stadt, wegen der schnellen Schließung des Belagerungsringes wurden sie vom sowjetischen Geheimdienst (NKWD) nicht ins Landesinnere deportiert, wie es vielerorts geschah. Ihre Geschichte ist in diesem Kontext besonders tragisch, da der NKWD sie oft des Verrats an NS-Deutschland verdächtigte und verfolgte.

7. Die sowjetischen Zeitungen ermutigten zur Organisation solcher hilfswirtschaftlichen Kleinbetriebe. Im Frühjahr 1942 erschienen mehrere Appelle: „viele verlassen sich ausschließlich auf die zentralorganisierte Versorgung. Sie verhalten sich gegenüber dem Staat als Unterhaltsempfänger. Das ist falsch. In einer Kriegssituation darf man nicht alles aus den zentralen Einrichtungen bekommen. Die Erfahrung zeigte, dass bei den Betrieben mit solchen Nebenwirtschaften Menschen einen großen Zugewinn für ihre Ernährung bekommen.“
Aus den Erinnerungen von Dmitrij Lazarev, der das Anlegen der privaten Gärten in Leningrad beobachtete.
Juni-Juli 1942. Die neuen Frühlingsanzeigen haben einen friedlichen Charakter. „Leningrader, verliert nicht die kostbare Zeit, organisiert schneller durch die Rayonsräte die Bodenstücke für die privaten Gärten und beginnt mit deren Bearbeitung. Das Saatgut bekommt ihr in den Läden, die es nun in jedem Stadtrayon gibt.“ „Jeder Werktätiger Leningrads soll zu seiner bürgerlichen Pflicht zählen, das Gemüse für sich selbst und seine Angehörige auf dem privaten Gemüsegarten anzubauen“. In der Stadt sind große leerstehende Räume zu den Gemüsegärten geworden. Ein Teil davon gehört den Betrieben und wird kollektiv von den Mitarbeitern bearbeitet.
9. Alle möglichen Pflanzen und Kräuter wurden gegessen und sogar auf den Märkten gehandelt: Brennessel, Bärlauch, Wegerich, Löwenzahn, Assel, Melde. Kartoffeln kosteten genauso viel wie Brot – 500 Rubel für ein Kilo. In den Parks, auf den leerstehenden Plätzen, auf dem Marsfeld sammeln Menschen Champignons. Einige geschickte Leningrader sammeln viel und tauschen gegen Brot – Kilo für Kilo.