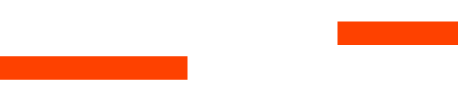Blockade Leningrads in den Aufzeichnungen des 16-Jährigen Schülers Jurij Rjabinkin 1941-1942.
Tagebuch
Die Tagebücher der Kinder des belagerten Leningrads sind ein ergreifendes Zeugnis für die Schrecken des Krieges. Das Tagebuch eines Gymnasiasten, Jurij Rjabinkin, ist eindrücklich. Die Einträge des Jungen zeigen, wie selbst grundlegende menschliche Werte – die Beziehung zwischen Eltern und Kindern – durch den Hunger zusammenbrechen.
22. Juni
28. Juni
31. August, 1. September
15. September
26. September
1-2. Oktober
29. Oktober
9.-10. November
9.-10. November… (Fortsetzung)
28. November
5. Dezember
24. Dezember
4. Januar
6. Januar
22. Juni <1941>
Ich wurde die ganze Nacht von irgendeinem summenden Geräusch vor dem Fenster wachgehalten. Als es am Morgen endlich ein wenig nachließ, dämmerte es bereits. Die Nächte in Leningrad sind mondbeschienen, hell und kurz. Aber als ich aus dem Fenster schaute, sah ich mehrere Suchscheinwerfer über den Himmel huschen. Ich bin dann doch eingeschlafen. Ich bin um elf Uhr nachmittags aufgewacht, oder eher morgens. Ich zog mich schnell an, wusch mir das Gesicht, aß und ging in den Garten des Palastes der Pioniere. Diesen Sommer habe ich beschlossen, mich im Schach zu qualifizieren. Schließlich gewinne ich oft, auch gegen die dritte Kategorie.
Als ich nach draußen ging, bemerkte ich etwas Sonderbares. An unserem Hauseingang sah ich einen Hausmeister mit einer Gasmaske und einer roten Armbinde am Arm. In allen Höfen ereignete sich das Gleiche. Die Polizisten trugen Gasmasken, und selbst an allen Kreuzungen lief das Radio. Irgendetwas sagte mir, dass über die Stadt ein Ausnahmezustand verhängt worden war.
Als ich im Palast ankam […]und das Schachspiel auf dem Brett anordnete, hörte ich etwas Neues, und als ich mich umdrehte, sah ich eine Gruppe von Kindern, die sich um einen kleinen Jungen scharten. Ich habe zugehört und … bin erstarrt …
„… Gestern um 4 Uhr morgens haben deutsche Bomber Kiew, Zhitomir, Sewastopol und anderswo angegriffen“, berichtete der Junge aufgeregt, „Molotow sprach im Radio. Jetzt sind wir im Krieg mit Deutschland!“
Ich habe mich einfach nur verblüfft hingesetzt. Was für Neuigkeiten! Und ich habe so etwas nicht einmal vermutet. Deutschland! Deutschland ist im Krieg mit uns! Deshalb haben alle Gasmasken.

Mein Kopf dreht sich wie verrückt. Ich kann nicht klar denken. Ich habe drei Spiele gespielt. Ich, ein Spinner, ich habe alle drei gewonnen und bin nach Hause getaumelt.
Auf der Straße blieb ich vor einem Lautsprecher stehen und hörte mir die Rede von Molotow an.
Als ich nach Hause kam, war nur meine Mutter da. Sie wusste bereits, was geschehen war.
Nach dem Mittagessen spazierte ich durch die Straßen. Überall herrschte Spannung, die die ganze stickige, staubige Atmosphäre der Stadt füllte. Auf dem Rückweg nach Hause stand ich in der Schlange für eine Zeitung. Es gab noch keine Zeitung, aber die Schlange war riesig. In der Warteschlange kursierten neugierige Gespräche, Witze zur Weltpolitik und skeptische Bemerkungen.
– Was würde passieren, wenn Deutschland mit England Frieden schließt und uns angreift?
– Jetzt werden wir alles bombardieren, nicht wie in Finnland, auch Wohngebiete, das Proletariat soll verstehen, worauf es sich einlässt.
– Wir haben gehört, dass ein deutsches Flugzeug in der Nähe von Olgino abgeschossen wurde!
– Da ist er gar bis dahin gekommen!
– Ja, machen Sie sich bereit, bombardiert zu werden. Wenn dreihundert Leningrad anfliegen …
– Das wird so sein. Es kommt, wie es kommen muss.
[…]
Der Tag neigt sich dem Ende zu. Es ist halb zwölf auf der Uhr. Ein entscheidender und ernsthafter Kampf hat begonnen, zwei antagonistische Systeme stoßen aufeinander: Sozialismus und Faschismus! Von der Zukunft dieses großen historischen Kampfes hängt das Wohl der gesamten Menschheit ab.“
28. Juni.
Ich habe heute wieder beim Pionierhaus¹ am Bau eines Luftschutzbunkers gearbeitet. Die Arbeit war qualvoll. Wir sind heute Maurer geworden². Ich habe mir meine Hände mit einem Hammer zerschlagen und sie sind jetzt ganz zerkratzt. Aber die nächste Schicht kam ziemlich früh, um 3 Uhr. Wir haben also viereinhalb Stunden lang gearbeitet, aber wie!!!
[…]
31. August, 1. September.
Leningrad ist eingekesselt! Ein deutscher Landungstrupp ist in der Nähe des Bahnhofs Iwanowskaja¹ gelandet und hat unsere Stadt vom Rest der UdSSR abgeschnitten …
Meine Stimmung ist untergegangen. Ich weiß nicht, ob meine Fröhlichkeit jemals wiederkehren wird.
[…]
Morgen wäre ich 16 Jahre alt geworden. Ich bin – 16 Jahre alt!
15. September.
Heute Morgen habe ich beschlossen: Ich gehe nicht in die Spezialschule¹. Den Grund werde ich hier nicht nennen. Ich weiß nicht, was mich diese Entscheidung gekostet hat. Die Tränen treten mir immer noch in die Augen, aber ich habe es hinausgezögert. Jetzt ist es vorbei. Wie dem auch sei, ich weiß es auch nicht. Ich meine, was wäre das für ein Pech für meine Mama! Und gleichzeitig weiß ich, dass es die richtige Lösung war.
Als ich meiner Mama² von dieser Entscheidung erzählte, versuchte sie, meine Absicht zu durchblicken. Ich beschloss, mich in Schweigen zu hüllen. Aber das hat nicht so gut geklappt. Dann habe ich Begründungen erfunden: so und so, ich mochte die Schule nicht. Sie hatte sofort lächerliche Verdächtigungen: Sie hatte Angst, dass ich an die Front geschickt werden würde oder ähnlich Schlimmes.
[…]
Es ist zu lange her, dass ich im Kino war³. Natürlich muss ich mir die „Kino-Reportage von der Front“ und einige Spielfilme ansehen. Aus Kummer begann ich wieder, zu schreiben. Eine interessante Bemerkung: Je mehr ich beschäftigt bin, desto weniger schreibe ich in mein Tagebuch.
1. Es handelt sich um die Sonderschule der Marine, die Jurij Rjabinkin aus gesundheitlichen Gründen nicht besuchen konnte, da er Probleme mit seinem Sehvermögen und einer Rippenfellentzündung hatte. Aus dem gleichen Grund meldete er sich nicht freiwillig an die Front.
2. Jurijs Mama hieß Antonina Mihajlowna Pankina. Sie war Leiterin des Bibliotheksfonds im Regionalkomitee der Union des Industriebauzentrums, Parteiarbeiterin, seit 1927 Mitglied der KPdSU (b).
3. Seit Beginn des Krieges wurden Filmteams gebildet, die Chroniken von militärischen Schlachten filmten, um die Stimmung und die patriotischen Gefühle der Bevölkerung zu heben. Diese Filme wurden häufig im Exil in den Mosfilm- und Lenfilm-Studios in Alma-Ata in Zentralasien gedreht.
26. September.
Kürzlich sind neue Umstände für meine Entscheidung präsent geworden. Ich weiß nicht, woher meine Mama das hat, aber sie sagt, dass ab dem 1. Oktober jeder ab 16 Jahren in die Arbeitsbrigaden aufgenommen wird. Als ich ihr sagte, dass ich nicht auf eine Sonderschule gehen würde, gab es eine Szene. Sie flehte und flehte mich an, zu gehen …
Nun, trotzdem … Ich gehe in die Spezialschule, um meine Mama zu trösten (für einen Tag), und sie, die Arme, weiß nicht, welche Art von Trost sie bekommen wird. In den Kurzberichten steht nicht viel. Ich glaube nicht an die Gerüchte. Gestern gab es wieder Artilleriebeschuss in der Stadt.
1. und 2. Oktober.
In den letzten Tagen sind meine Sturheit und mein Stolz in meinem Charakter sehr deutlich hervorgetreten. Ich glaube, das liegt an der ständigen Aufregung. Poltawa ist aufgegeben worden, viel mehr weiß ich nicht. Die Konferenz zwischen den Vereinigten Staaten, Großbritannien und der Sowjetunion zur Unterstützung der Sowjetunion gegen Deutschland ist beendet.
[…]
Ich bin sechzehn Jahre alt, aber meine Gesundheit ist wie bei einem sechzigjährigen Greis. Ich wünschte mir, der Tod würde früher kommen. Ich wünschte mir, meine Mama wäre nicht so deprimiert darüber.
Gott weiß, welche Gedanken mir durch den Kopf gehen. Eines Tages, wenn ich dieses Tagebuch wieder lese, werde ich oder wird jemand anderes beim Lesen dieser Zellen verächtlich lächeln (und das wäre noch in Ordnung), wenn nicht sogar schlimmer, aber das ist mir im Moment egal.
Seit der frühen Kindheit nährte ich meinen Traum: Ich wollte Seemann werden. Und jetzt zerfällt dieser Traum zu Staub. Wofür habe ich dann gelebt? Wenn ich nicht auf die Kriegsmarinespezialschule gehe, werde ich zur Volkswehr oder sonst wo hingehen, zumindest, um nicht nutzlos zu sterben. Werde ich sterben, so werde ich bei der Verteidigung meines Heimatlandes sterben.
[…]
29. Oktober.
Ich kann meine Beine vor Schwäche kaum bewegen, und Treppensteigen fällt mir sehr schwer. Meine Mama sagt, dass sich mein Gesicht langsam aufbläht. Das liegt daran, dass ich unterernährt bin.
[…] Nun kümmere ich mich selten um sich selbst. Ich schlafe voll angezogen, wasche mir morgens einmal das Gesicht, wasche mir die Hände nicht mit Seife und wechsle die Kleidung auch nicht. Unsere Wohnung ist kalt und dunkel, und wir verbringen alle Nächte bei Kerzenlicht.
Aber das Schlimmste, das Schlimmste daran ist, dass während ich hier im Hunger lebe, in Kälte, unter Flöhen, es nebenan einen Raum gibt, in dem das Leben ganz anders ist – immer Brot, Brei, Fleisch, Süßigkeiten, Wärme, eine helle estnische Petroleumlampe, Komfort … Das nennt man Neid – was ich beim Denken an Anfisa Nikolaewna¹ empfinde, aber das kann ich nicht überwinden.
Ich habe niemanden, zu dem ich gehen kann. Zu meinen Kameraden? Ich habe keine. Wowka ist in Kasan, Mischka ist bei der Arbeit. Und solche Leute […] sind durch und durch egoistisch, warum also zu ihnen gehen …? Also Neid, sogar Wut, ein bitterer Groll erwacht wieder in mir.

1. Anfisa Nikolaewna Iwanowa war eine Mitbewohnerin von Juris Familie. Sie war die Frau des Treuhänders Nikolai Matwejewitsch Iwanow, der im September 1941 in die Wohnung der Rjabinkins einzog.
9. und 10. November.
Jeden Tag träume ich von Brot, Butter, Kuchen und Kartoffeln. Und vor dem Einschlafen bohrt der Gedanke, dass in 12 Stunden die Nacht vorbei sein wird und man ein Stück Brot zu essen bekommt …
[…] Ira¹, zum Beispiel, lehnt sogar eine Extraportion Suppe am Abend ab. Und beide sagen mir, dass ich wie ein Arbeiter esse, mit der Begründung, dass ich zwei Schüsseln Suppe in den Kantinen esse und sogar mehr Brot esse als sie. Aus irgendeinem Grund hat sich mein ganzer Charakter jetzt drastisch verändert. Ich bin träge geworden, müde – ich schreibe und meine Hand zittert, ich gehe, aber meine Knie sind so schwach, dass ich keinen Schritt mehr machen kann und hinfallen muss.
1. Juris Schwester Irina Iwanowna Rjabinkina. Im Januar 1942 konnte sie mit ihrer Mama nach Wologda evakuiert werden. Am Tag der Evakuierung starb ihre Mama, so dass Irina bis 1945 in einem Waisenhaus im Dorf Nikitskaya in der Region Wologda lebte, wo sie nach dem Krieg von ihrer Tante aufgenommen wurde.
9. und 10. November… (Fortsetzung).
Und doch kann ich mit Gewissheit zugeben, dass wenn es keine Gesättigten nebenan gäbe, ich mich an all das mindestens gewöhnt hätte. Anders ist es, wenn jeder Ton […] mich mit etwas Fröhlichem, Nahrhaftem erfüllt. Vor mir, in der Küche sitzend, sehe ich den Topf auf dem Herd stehend mit halb gegessenen Mittagessen, Abendessen und Frühstück, das Anfisa Nikolaewna zurücklässt, ich kann nicht mehr … Ich bin hin- und hergerissen, buchstäblich, natürlich nicht, aber es scheint mir so… Und der Duft von Brot, Pfannkuchen und Brei kitzelt meine Nase, als wollte er sagen: „Siehst du! Siehst du! Und du verhungerst, du darfst nicht …“ Ich bin an Bombenangriffe gewöhnt, aber daran kann ich mich nicht gewöhnen – ich kann das nicht!
[…]
Mama und Ira kommen herein, hungrig, kalt, müde … Sie können kaum beim Gehen ihre Füße nachschleifen. Kein Essen zu Hause, kein Holz für den Herd … Und Schimpfen, Zureden, dass unten jemand wohnt, der Grütze und Fleisch bekommt, und ich so etwas nicht besorgt habe. Als ob es Fleisch in den Geschäften gab und ich es nicht bekommen konnte. Und meine Mama breitet überrascht die Arme aus, macht ein naives Gesicht und sagt, als ob sie stöhnt: „Na ja, ich bin auch beschäftigt, ich arbeite. Ich kann es nicht besorgen.“ Und wieder stelle ich mich an, aber ohne Erfolg. Mir ist klar, dass ich allein Nahrung besorgen und uns alle drei wieder ins Leben zurückbringen kann. Aber ich habe nicht genügend Kraft, Energie, um das zu tun. Ach, wenn ich doch nur Filzstiefel hätte! Aber ich weiß nicht … Und jeder Schritt bringt mich der Rippenfellentzündung näher, der Krankheit … Ich habe beschlossen, dass ich lieber Wassersucht haben möchte¹. Ich werde so viel trinken, wie ich kann. Jetzt sind meine Wangen geschwollen. Noch eine Woche, ein Jahrzehnt, ein Monat, und wenn ich bis Neujahr nicht an einer Bombe sterbe, werde ich angeschwollen sein.
Ich sitze und weine … Ich bin erst sechzehn Jahre alt! Die Schweinehunde, die diesen ganzen Krieg verursacht haben …
Auf Nimmerwiedersehen, Kindheitsträume! Sie werden nie zu mir zurückkommen. Ich werde euch meiden wie die Pest, wie die Tollwut. Ich wünschte, die ganze Vergangenheit würde in Trümmer gehen, damit ich nicht wüsste, was Brot ist, was Wurst ist! Damit ich nicht von Gedanken an vergangenes Glück betäubt werde! Glückseligkeit! Das ist eine der besten Bezeichnungen meines alten Lebens. Seelenfrieden für meine Zukunft! Was für ein Gefühl! Ich werde es nie wieder erleben …
Ich wünschte mir, dass Tina² das Tagebuch in ihrem Zimmer in Schlüsselburg³ beim Teetrinken und bei einem Butterbrot lesen könnte! Was wir in Leningrad erleben, hat sie noch niemals zuvor erleben müssen.
1. Ab November 1941 erkrankte die Mehrheit der Einwohner des belagerten Leningrads an Alimentärdystrophie. Manche trockneten bis auf die Muskeln aus („trockene Dystrophie“), und manche schwollen zu schmerzhafter Fülle an („totale Dystrophie“), da der Körper nicht in der Lage war, Flüssigkeit auszuscheiden. Viele versuchten, den Mangel an Nahrung durch Wasser zu ersetzen, überzeugt, dass der „satte“ Dystrophiker seltener stirbt als der „trockene“.
2. Walentina Michailowna Pankina, Jurijs Tante, bei der er bis zu seinem siebten Lebensjahr außerhalb der Stadt lebte. Während des Krieges wurde sie vom Morozow-Krankenhaus in ein Evakuierungskrankenhaus untergebracht, wo sie bis 1945 arbeitete. Nach dem Krieg nahm sie Jurijs Schwester Irina Rjabinkina auf.
3. Eine Stadt am linken Ufer der Newa, die 35 Kilometer östlich von Sankt Petersburg entfernt ist.
28. November.
[…] Heute werde ich meine Mama auf Knien bitten, mir die Brotkarte von Irina zu geben. Ich werde auf dem Boden bleiben, und wenn sie auch hier nein sagt … Dann habe ich keine Energie mehr, um meine Füße nachzuschleifen. Heute geht der Tagesalarm wieder für etwa drei Stunden an. Die Geschäfte sind geschlossen, aber wo kann man denn Kartoffelmehl und Marmelade herkriegen? Ich gehe heraus, wenn der Alarm vorbei ist. Ich habe die Hoffnung auf eine Evakuierung schon längst aufgegeben. Das ist alles nur Gequatsche … Ich werde die Schule abbrechen – ich kann es nicht fassen. Und wie kann das gehen? Zu Hause gibt es Hunger, Kälte, Schimpfen, Weinen und die wohlgenährten Iwanows. Jeder Tag gleicht dem vorhergehenden in seiner Monotonie, in Gedanken, Hunger, Bombenangriffen, Beschuss. […]
Meine Mama wird heute kommen und Irina meine Brotkarte wegnehmen. Na gut, ich opfere sie für Irina, dann bleibt sie wenigstens von dieser Hölle noch am Leben […] und ich werde schon irgendwie zurechtkommen … Nur, um hier herauszukommen … Nur, um hier herauszukommen … Was bin ich doch für ein Egoist! Ich bin gefühllos, ich bin … Was ist aus mir geworden! Bin ich noch derselbe Mensch wie vor 3 Monaten? … Vorgestern löffelte ich in Anfisa Nikolaewnas Topf, ich klaute Butter und Kohl aus den verborgenen Reserven, ich sah gierig zu, wie meine Mama ein Bonbon teilte […] und mit Ira schimpfe ich wegen jedem Bissen, jedem Brotkrümel … Was ist aus mir geworden? Ich habe das Gefühl, um wieder ein solcher Mensch zu werden, der ich war, dass die Hoffnung und die Gewissheit, dass ich und meine Familie morgen oder übermorgen evakuiert werden, genug für mich wären, aber es wird nicht passieren. Es wird keine Evakuierung geben, und trotzdem habe ich eine heimliche Hoffnung im Hinterkopf. Wenn sie nicht wäre, würde ich stehlen, rauben, ich weiß nicht, wozu ich mich noch hinreißen lassen würde. Nur zu einer Sache hätte ich mich nicht hinreißen lassen: Ich hätte nie geschummelt. Das weiß ich mit Sicherheit. Und alles andere … Ich kann nicht mehr schreiben – meine Hand ist eingefroren.


5. Dezember.
Mama hat schon recht, man muss immer an das Beste glauben. Im Moment müssen wir glauben, dass wir evakuiert werden. So dürfte es auch sein. Und das wird es auch. Auch wenn Mama kaum laufen kann – es wird ihr bessergehen, auch wenn Ira über Bauchschmerzen in der linken Seite klagt. Obwohl meine Mama und ich kein Schuhwerk tragen, wir haben keine Filzstiefel und keine warme Kleidung, werden wir aus dieser Hungergefangenschaft – Leningrad – entkommen. Aber jetzt ist es Abend, der Alarm ertönt, die Flugabwehrkanonen schlagen, die Bomben zerfetzen … Es wird eine schreckliche Lotterie gespielt, bei der ein Mann mit seinem Leben gewinnt und mit seinem Tod verliert. So ist das Leben. Iwanows werden morgen nicht evakuiert werden. Irgendwann später werden sie abreisen. Glückliche Menschen …
Hunger. Eine grausame Hungersnot!
[…]
24. Dezember.
[…] Der Mama wird im Bezirksausschuss versprochen, dass sie am 28/12 evakuiert wird … Jetzt ist meine Mama wegen der Sache zum Bezirksausschuss gegangen. Wenn die Evakuierung bis zum 1. Januar verschoben wird, sind wir am Ende, denn wir haben nur noch für zwei Tage Lebensmittelkarten, kaum drei. Nichts weiter als das. Der Gesundheitszustand der Mama wird immer schlechter. Ihr Tumor ist bereits auf ihre Hüfte übergegangen. Ich habe die Schnauze gestrichen voll … Ich und Ira sind ein bisschen geschwollen im Gesicht. Heute sind uns die Süßigkeiten ausgegangen. Morgen – Maisgrütze. Übermorgen – Fleisch und Butter. Und dann, dann …
Stille Traurigkeit, erdrückend. Schwer und schmerzhaft. Traurigkeit und schwerer Kummer. Vielleicht etwas anderes. Wenn ich aus der Küche in unsere Wohnung gehe, erinnere ich mich nur an die Tage, die Abende, die ich hier verbracht habe. In der Küche gibt es immer noch eine Art Vision von unserem Vorkriegsleben. […]
Es gab ein Sofa, einen Schrank, Stühle, ein halb aufgegessenes Abendessen auf dem Tisch, Bücher im Regal, und ich lag auf dem Sofa und las „Die drei Musketiere“, aß ein Brötchen mit Butter und Käse oder knabberte an Schokolade. Das Zimmer war heiß, und ich „immer zufrieden mit mir selbst, mit meinem Mittagessen und …“. Letzteres hatte ich nicht, aber ich hatte Spiele, Bücher, Zeitschriften, Schach, Kino … und ich machte mir Sorgen, nicht ins Theater zu gehen oder so, ab und zu hatte ich bis zum Abend kein Mittagessen, sondern lieber Volleyball gespielt und Kumpels getroffen … Und schließlich, wie es war, sich an das Leningrader Pionierhaus zu erinnern, an seine Abende, den Lesesaal, die Spiele, den historischen Klub, den Schachklub, den Nachtisch in seiner Kantine, die Konzerte, die Bälle … Das war ein Glück, das ich nicht einmal geahnt habe – das Glück, in der Sowjetunion zu leben, in Friedenszeiten, das Glück, eine Mama zu haben, die sich um dich kümmert, eine Tante, und zu wissen, dass dir niemand die Zukunft wegnehmen wird. Das ist Glück.
[…]
4. Januar.
Und es wird noch einen ganzen Monat dauern, bis sich die Ernährungslage und die Ausreisebedingungen verbessern. Was wird am Ende dieses Monats mit uns geschehen, was für Arme werden wir, wenn wir nicht durch eine glückliche Fügung des Schicksals, durch die Gnade Gottes, durch eine himmlische Rettung morgen, übermorgen, bis zur Mitte des zweiten Jahrzehnts von hier weggeholt werden … […] Und ich schwöre bei allem, was ich habe, dass ich meinem schändlichen, betrügerischen Leben für immer ein Ende setze und dennoch ein ehrliches und arbeitendes Leben in irgendeinem Dorf beginne und meiner Mama einen glücklichen, goldenen Lebensabend bereiten werde. Nur der Glaube an Gott, nur der Glaube, dass das Glück mich und uns drei morgen nicht verlassen wird, der Glaube an Paschins Antwort im Bezirksausschuss – „Fahren“ – nur das bringt mich auf die Beine. Wenn das nicht so wäre, wäre ich tot. Aber ich möchte bleiben, oder besser gesagt, ich würde gerne, aber ich kann nicht … Nur die morgige Abreise … Ich werde Ira und meiner Mama etwas Gutes zurückzahlen können. Herr, rette mich, gewähre mir die Evakuierung, rette uns alle drei, Mama, Ira und mich …!
6. Januar.
Ich kann kaum noch laufen oder arbeiten. Fast ein völliger Energieverlust. Meine Mama kann auch kaum noch gehen – ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sie es schafft, zu laufen. Jetzt schlägt sie mich oft, schimpft mit mir, schreit mich an, hat heftige Nervenzusammenbrüche, sie kann mein wertloses Aussehen nicht ertragen – den Anblick eines kraftlosen, hungernden, erschöpften Mannes, der sich kaum von Ort zu Ort bewegen kann, sich rührt und so tut, als sei er krank und kraftlos. Aber ich täusche meine Hilflosigkeit nicht vor, nein! Es ist keine Täuschung, die Kraft […] aus mir geht, geht, schwebt [davon] … Und die Zeit läuft und läuft und läuft für eine lange, lange Zeit …! Oh Gott, was ist mit mir passiert?
Und jetzt ich, ich, ich …
Über Jurij

Jurij spielt Schach am 22. Juni 1941. Künstlerin: Arin.N.
Zu Beginn des Krieges lebt Jurij zusammen mit seiner Mutter und Schwester in Leningrad.
Am 22. Juni 1941 marschiert die deutsche Wehrmacht in die Sowjetunion ein – da ist Jurij gerade einmal 16 Jahre alt. An diesem Tag beginnt er Tagebuch zu schreiben. In seinen Einträgen beschreibt er eindrücklich die sich stetig verschlechternde Situation für ihn und seine Familie. Er schreibt über Hunger, Not und darüber, wie das Hungern sie alle drei um den Verstand bringt.
Während seine Schwester und Mutter am 8. Januar 1942 evakuiert werden können, bleibt Jurij völlig entkräftet und allein in der eiskalten Wohnung zurück. Er überlebt die Blockade nicht. Sein letzter Tagebucheintrag vom 6. Januar lautet: „Und jetzt, ich, ich, ich…”