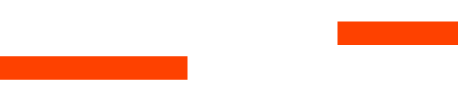Erst dann begann man, so Zinovij, wieder „normal“ zu essen. Frida arbeitete in einem Buchladen und Zinovij erinnert sich gerne an die spannende Jugendliteratur, die seine Mutter aus dem Buchladen mitbrachte.
Nach dem Kriegsende kehrte die Familie nicht nach Leningrad zurück (Frida befürchtete eine erneute Verfolgung wegen der Repressionsgeschichte des Vaters), sondern zog nach Charkiv. Erst 1961, als der Vater offiziell rehabilitiert war, kam die Familie nach Leningrad zurück. Hier bekamen sie eine Wohnung in der Stadt.
Während des Interviews trägt Zinovij eine Medaille mit grün-gelbem Band: die Auszeichnung zum „Bewohner des belagerten Leningrads“. Diese wurde 1989 durch die Stadtverwaltung Leningrads eingeführt und brachte gewisse soziale Leistungen und Privilegien mit sich. Doch nicht alle „blokadniki“ erhielten sie. Eine Voraussetzung war das Verbringen von mindestens vier Monaten in der belagerten Stadt (innerhalb des Blockadezeitraums 08.09.1941 – 27.01.1944). Als Zinovij sich darum kümmerte, Zeugnisse darüber zu sammeln, dass er als kleiner Junge im „Todeswinter“ 1941/42 in Kolomjagi lebte, musste er feststellen, dass von seinem damaligen Holzhaus nur ein Bombenkrater geblieben war. Abermals ein Beweis, dass die Evakuierung lebensrettend war … Die „Blokadnik-Medaille“, wie sie umgangssprachlich bezeichnet wird, ist für die Überlebenden von gewaltiger Bedeutung: Dieses Symbol macht das Überleben zu einer zivilen Heldentat, wertet die blokadniki als auf gleicher Ebene stehend mit den Frontkämpfern auf und ist ein Zeichen der kollektiven Solidarität mit allen anderen Schicksalsgenossen …