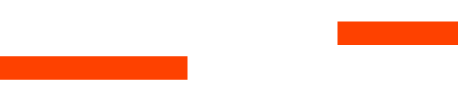Zinaida Spindler
Geboren 1936 in Leningrad, blieb mit ihrer Familie bis Februar 1942 in der Belagerung und kehrte Dezember 1942 in die Stadt zurück.
„Es fällt mir schwer, über die Blockade zu sprechen, ich gehöre nicht zu denen, die endlos darüber reden, in Erinnerungen schwelgen, nein, das ist alles sehr… Nein. Für mich… Ich mag es nicht, darüber zu sprechen, darauf zurückzukommen oder darüber zu reden, denn Gott bewahre, von dem was wir erlebt hatten…“

Anfang des Krieges
Meine Mutter hat vor dem Krieg nicht gearbeitet, und wir waren drei Kinder in der Familie. Meine Schwester wurde vor dem Krieg zur Schwester meines Vaters irgendwo in der Region Smolensk gebracht, sie geriet dort unter die deutsche Besatzung. Mein älterer Bruder Akiwa und ich haben die Stadt zuerst in die südliche Richtung verlassen, weil wir dachten, dass die Deutschen aus dem Norden angreifen werden, von Finnland aus.1 So wurden wir in die Nähe von Gatschina in der Region Leningrad in das Dorf Elizavetino geschickt. Und ich erinnere mich, dass wir nachts in einer Schule untergebracht wurden, und plötzlich hörten wir Schreie, dass Deutsche im Wald seien. Wir bekamen alle eine Gänsehaut, wie man so sagt. Sie warfen uns alle raus und sagten uns, wir sollten zum Bahnhof rennen und nach Leningrad zurückgehen. Ich erinnere mich gut an diese Szene, als ich keine Hose für mich finden konnte (verzeihen Sie mir), dann gaben sie mir eine Hose, ich zog sie nicht an, ich schimpfte, stritt mit meinem Bruder, und wir mussten dringend zum Bahnhof rennen, weil die Deutschen im Wald waren. Ich weiß nicht mehr, wie es ausging, aber wir erwischten einen Zug, um wegzufahren.
Von unserem Zug kamen in Leningrad nur eine Dampflok und der erste Wagen an, denn der Zug wurde auf der Bahnstrecke bombardiert und fast komplett vernichtet. Mein Bruder, so stellte sich heraus, war zufällig in diesem ersten Wagen, da er durch den ganzen Zug lief, um nach mir zu suchen. Und meine Mutter sagte, sie würde uns nie wieder irgendwohin schicken, und wenn wir sterben sollten, würden wir hier zusammen sterben.
Schließlich sind wir – mein Bruder und ich – über den Ladoga-See evakuiert worden, mit ein paar Fremden. Das war im Februar 1942. Unsere Mutter brachte uns zu einem LKW, der auf der anderen Seite des Sees fuhr, und wir landeten in der Evakuierung im Gebiet Kirow in einem Internat dort. Mein Bruder und ich mussten in zwei verschiedenen Lastwagen fahren, es war schrecklich: Er fuhr im Wagen vorne und ich in einem anderen Wagen hinter ihm, und es war ein Grauen sich vorzustellen, dass ein Auto vor deinen Augen versinkt, wenn es in ein Eisloch fällt. Ich hatte meinen Bruder immer im Blick, die Lastwagen hatten ja kein Dach. Und ich sah auf dem Weg die in Eislöcher gestürzten Autos… Als wir uns am anderen Ufer trafen, das war so eine Freude! Und dann sind wir zu Fuß gelaufen, Akiwa wusste offenbar den Weg, ins Internat im Dorf Schichowo.
“Das Schlimmste war, bei Luftalarm auf einer Brücke zu sein.”
Mama
Wir hatten ein Zimmer von 25 Quadratmetern, wir wohnten in einer Kommunalwohnung und das Kinderbett stand neben dem Küchenschrank. Ich erinnere mich, dass meine Mutter die Tür öffnete und eine Tüte mit Kekskrümeln und Mäusekot herausholte, daran erinnere ich mich sehr gut. Sie gab mir einen Teelöffel und ich fragte nach mehr, und sie sagte: “Nein, nächstes Mal” und stellte die Tüte mit den Kekskrümeln weg. Meine Mutter war, na ja, von Natur aus einfach ein fürsorglicher Mensch.
Im belagerten Leningrad hat man Katzen gegessen und bald gab es in der Stadt keine Katzen mehr. Ich erinnere mich an eine solche Szene: Meine Mutter und ich liefen irgendwohin, und zu dieser Zeit rannte jemand hinter einer Katze her, und ich riss mich aus der Hand meiner Mutter los und rannte mit ihm hinter der Katze her. Und sie schlich sich irgendwo in eine Seitengasse, und wir standen ohne Katze da, und meine Mutter schimpfte mit mir.
In den Luftschutzkeller sind wir mehrmals am Tag gerannt, und Mama hat manchmal ein Kissen unter dem Arm getragen, weil es im Luftschutzkeller nicht immer einen Platz zum Sitzen gab. Nun, ich bin 1943 zur Schule gegangen, im belagerten Leningrad, und der Unterricht fand oft im Luftschutzkeller statt. Eine Bombe traf unsere Schule und explodierte im Innenhof. Ich erinnere mich an die Häuser, die völlig zerstört wurden. An ihrer Stelle hatte man Gärten, oder, wie wir sie nannten, Staubfänger, angelegt.
Und es war beängstigend, als die Bombardierung begann und meine Mutter von der Arbeit noch nicht nach Hause gekommen war. Sie arbeitete am Rand der Stadt, im Gebiet Rzhevka, wo sie Handschuhe für die Front nähte und Gräben ausgrub. Sonntags gingen wir in die Stadtwohnung nach Hause. Und alle Türen waren hier natürlich offen, man ging im Dunkeln den Gang entlang, und man tastete mit den Händen, weil jemand im Gang liegen konnte, wenn er von der Straße nach einem Versteck suchte.
Das Schlimmste im belagerten Leningrad war, mitten in einem Flugalarm über eine Brücke zu gehen. Da meine Mutter auf einem anderen Ufer von Newa arbeitete (Rzhevka), mussten wir oft über eine Brücke laufen. Das Schlimmste war, auf der Ochtinskij-Brücke zu sein, weil der Alarm losging und man sich nirgendwo verstecken konnte. Und hier gingen wir, und plötzlich stieß mich meine Mutter vor sich, sie fiel zu Boden und deckte mich mit ihrem Körper zu. Ich hatte so einen Eindruck, dass dieses Flugzeug flog und ich es sehen konnte, wie es schießt. Oder es kam mir vielleicht nur so vor, ich weiß es nicht, aber es war sehr fürchterlich. Und dann konnte ich nicht mehr von der Brücke aufstehen, meine Mutter hat mich zum anderen Ufer geschleppt, bis ich wieder zur Vernunft gekommen bin und wir nach Hause gelaufen sind.
“… und sie tauschte ihr Klavier gegen Brot.”
Wir wohnten im 2. Stock, wir hatten ein Fenster zum Hof und eine breite Fensterbank, und jedes Mal, wenn wir am Sonntag nach Hause kamen, gab es kein Licht in der Wohnung, wir gingen also im Dunkeln, weil jemand von der Straße in die Wohnung kommen konnte. Auf dieser breiten Fensterbank lag mehrmals eine Kinderleiche. Meine Mutter und ich legten sie im Winter auf einen Schlitten und brachten sie zum Friedhof des Frunzenskij Bezirks. Später gab es auf dieser ehemaligen Pferderennbahn in der Nähe des Witebsker Bahnhofs das Jugendtheater, das damals dort gebaut wurde. Später konnte ich nicht zu diesem Jugendtheater gehen, weil wir damals die Leichen dorthin brachten. Wir brachten die Leichen zu diesem Hippodrom, legten sie dorthin, und dann weiß ich nicht, wohin sie dann gebracht wurden, aber nach dem Krieg bauten sie dort das Jugendtheater. Ich hatte also den Eindruck, dass das Jugendtheater auf Knochen stand. Das hat mich mein ganzes Leben begleitet.
Ja, und hier ist noch eine Sache: Ich erinnere mich auch gut daran, wie meine Mutter mir kein Fischöl gab, sondern ein kleines Gläschen Wodka. Also mein Vater hat diesen Wodka an der Front2 bekommen, und wenn er von der Front kam, hat er ihn mitgebracht, und meine Mutter hat mich mit Wodka „gefüttert“. Denn Wodka ist nahrhaft und macht schläfrig, und man vergisst den Hunger.
“Während der Blockade aß man Katzen.”
Rückkehr nach Leningrad
Wie kamen wir aus der Evakuierung zurück nach Leningrad? Zuerst kam mein Vater von der Front, um uns im Internat im Dorf Schichowo zu besuchen und nach Leningrad zurückzubringen. Aber sie haben uns nicht mit ihm gehen lassen, weil mein Bruder auf eine Berufsschule gehen musste, denn alle Jugendlichen wurden auf eine technische Berufsschule für die Bedürfnisse der Front geschickt. Also konnten wir nicht mit Papa mitgehen. Und da mein Bruder auf diese Berufsschule geschickt wurde, hat er mich mit sich mitgenommen. Er nahm mich mit, und ich erinnere mich, dass ich nachts aus dem Internat weglief, mich in Heuhaufen versteckte und so weiter. Wir kamen mit ihm im Dezember (1942) nach Leningrad. Und ich erinnere mich, dass ich in einem Lastwagen in einem Fass mit Gurken mitgenommen wurde, mit einem Tuch bedeckt. Wir waren auf dem Weg zur Wolchow-Front, wo mein Vater diente. Wie auch immer, da waren Soldaten, die herumliefen und sangen. Und gerade, als ich aus diesem Fass herausschauen wollte, da kontrollierte die Patrouille das Auto. Mein Bruder schlug mir den Deckel auf den Kopf, und ich fiel in dieses Gurkenwasser, verschluckte mich – während die Patrouille das Auto kontrollierte. So kamen wir zu der Einheit meines Vaters, ich erinnere mich gut daran, und von dort nach Leningrad, wo mein Bruder in die Schule ging, und ich auch.
Wir wohnten nach dem Krieg im Zentrum von Leningrad, im zentralen Bezirk. Neben uns war die Krupskaja-Konditorei, auf der anderen Seite war das Kulturhaus der Lebensmittelindustrie, dort war während des Krieges ein Lazarett. Die Deutschen wussten das alles sehr gut, deshalb hatten sie unser Viertel gnadenlos bombardiert, einfach gnadenlos… Das Haus, das neben dem Krankenhaus an der Ecke unserer Sozialistischen Straße und der Prawda-Straße stand, wurde während des Krieges buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht, weil sie das Krankenhaus im Visier hatten, und auf dem Krankenhaus standen Flugabwehrkanonen. Als meine Mutter und ich eines Tages aus dem Luftschutzkeller kamen, hatten wir gesehen, dass vom Haus neben dem Lazarett nur eine Wand übriggeblieben war, und an der Wand hing eine Frau, mit einem Säugling, und es kam ein Kran, der diese tote Frau mit dem Kind abnahm.
Nach dem Krieg wurde dieses Haus von deutschen Gefangenen wieder aufgebaut, die in unserem Hof wohnten, wo das Nebengebäude abgerissen wurde, das einst zerbombt worden war. Wir haben, wenn wir im Hof spazieren gingen, immer Witze gemacht: “Guten morgen, guten tag, chlop po morde – vot tak tak,” – (dt. „Guten Morgen, Guten Tag – eine wische ich dir aus…“). Bis mein Vater eines Tages an einem Wochenende von der Front kam und ein Militärangehörige ihn ansprach, und etwas berichtete. Daraufhin erzählte uns mein Vater, dass nicht die Deutschen, sondern Hitler den Krieg begonnen hätte, und dass meine Eltern nun eine Strafe bekämen, weil wir die Deutschen (Kriegsgefangenen) geärgert hatten. Und danach haben wir den Ölkuchen für die Pferde, den wir nach Hause brachten, geschmolzen und auf ein Stück Brot geschmiert, das wir abgebrochen haben, dann haben wir es in eine Zeitung eingewickelt und es für die Deutschen unter das Brennholz, hinter den Stacheldraht gelegt. Einmal zeigte einer von ihnen uns ein Bild seiner Familie: drei Kinder und er und seine Frau. Und er sagte, dass die ganze Familie von Hitler „kaput“ (vernichtet) worden sei. Und er tat uns so leid, dass wir dann einige unserer Brote mit in den Hof nahmen und sie diesem Deutschen gaben. Und dann sind diese gefangenen Deutschen bei uns die Treppe rauf und runter gelaufen, ganz eingemummelt, und haben gefragt: “Brot Brot Brot”… Das war, als der Krieg noch nicht zu Ende war, aber die Blockade von Leningrad schon aufgehoben war…
“Immer wieder sah man Fahrzeuge ins Eis einbrechen.”
“Alle Fenster waren mit Papierstreifen beklebt.”
Nachhall der Blockade
Das Schlimmste ist, Brot auf dem Boden liegen zu sehen. Dieses Brot ist das Heiligste für mich. Ich habe immer Brot im Gefrierschrank. Brot sollte immer da sein. Und wie man sagt: Ich kann nichts auf dem Teller liegen lassen.
Wenn ich esse, sagen meine Kinder manchmal, besonders hier in Deutschland, zu mir: Mama, warum isst du das auf? Und ich denke: ich kann es nicht auf dem Teller liegen lassen. Ich kann nichts übriglassen, ich kann nicht sagen, dass etwas nicht schmeckt oder Ähnliches – ich kann es nicht…
1. Im sowjetisch-finnischen Krieg 1939-1940 ging das Finnisch-Karelien an die Sowjetunion über, doch Helsinki konnte die staatliche Souveränität bewahren. In diesem Krieg trug die Rote Armee immense Verluste davon – 120 Tausend Soldaten fielen den tödlichen Erfrierungen zum Opfer, die Verluste auf der finnischen Seite waren viel geringer – 25 Tausend. Als Finnland auf der Seite NS-Deutschlands in den deutsch-sowjetischen Krieg eintrat, eroberte es bis zum Herbst 1941 die an die Sowjetunion abgetretene Gebiete (Karelien) zurück.
Nachdem diese Rückeroberung abgeschlossen war, stellte die finnische Armee große Angriffe auf die Sowjetunion ein. Auch lehnte die finnische Regierung eine Unterstützung der deutschen Truppen bei der Belagerung Leningrads ab.
Obwohl die deutsche Führung auf das Heranrücken vom Norden drängte, blieben die Finnen auf der „alten“ sowjetisch-finnischen Grenze stehen. Durch den sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg ging das Gebiet Karelien wieder an die Sowjetunion über.