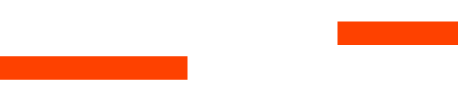Lev Kontorovitch
Er wurde 1933 in Leningrad geboren. Er überlebte den Todeswinter 1941/42 in der Stadt, bevor er im Sommer 1942 mit seiner Mutter und der kleinen Schwester evakuiert wurde. Dadurch, dass er sich um Milch für seine neugeborene Schwester kümmerte und Wasser holte, sicherte er der Familie gewissermaßen das Überleben.

Meine Mutter Zilja war Hausfrau, verdiente aber manchmal mit kleinen Aufträgen noch etwas dazu. Einige Tage vor dem Krieg kam meine kleine Schwester zur Welt. Da mein Vater nicht so jung war, wurde er nicht zur Armee eingezogen, aber er nahm am Bau von Befestigungen und Verteidigungsanlagen vor Leningrad teil.
Der 22. Juni 1941 war ein sonniger Tag, meine Mutter war noch mit meiner neugeborenen Schwester im Krankenhaus und meine Tante, meine Cousine und ich waren auf dem Weg
in den Kirowschen – „Zentralpark für Kultur und Erholung“. Plötzlich wurde der Kriegsbeginn per Lautsprecher in der ganzen Stadt verkündet.

“Die Leichen wurden auf Schlitten durch die Stadt transportiert.“
Die deutschen Luftangriffe begannen umgehend, es gab schwere Brände durch Sprengbomben. Viele Häuser im Stadtzentrum wurden durch Bombardierungen zerstört. Sprengbomben zerstörten die Gebäude bis auf die Grundmauern vollständig.
Meine Tante, die bei uns wohnte, fiel in den ersten Kriegstagen einem solchen Brand zum Opfer. Sie arbeitete als Leiterin der Planungsabteilung in der Wolodarskij-Fabrik und wurde dort von einer Sprengbombe getroffen und getötet.
Als Kind machte ich bei der Bürgerwehr mit, um diese Brände zu löschen. Man musste auf den Dachboden steigen und die Brandbomben löschen. Wir löschten sie mit Wasser, Sand oder dem, was gerade zu Hand war. Ich behielt so eine gelöschte Brandbombe und bewahrte sie im Badezimmer auf, und dann, als die Wohnung leer war und wir dort allein wohnten, hatte ich da einen geheimen Ort, an dem ich diese und andere Trophäen, zum Beispiel Granatsplitter, aufbewahrte. Ich war ja noch ein kleiner Junge und war neugierig auf alles.
Als die Bombenangriffe aufhörten, begann der Beschuss. Ich schaute aus dem Fenster, sah nach, welche Gebäude zerstört waren und hatte Angst, dass ich am nächsten Tag vielleicht nicht mehr da sein könnte.
Die Angst vor Menschen ersetzt die Angst vor Bomben
Wir wohnten in der Werejskaja-Straße, Ecke Sagorodnyj-Prospekt, einen Block vom Obwodnyj-Kanal entfernt. Alle Straßen in diesem Viertel waren mit Barrikaden abgesperrt, damit die Panzer nicht durchkamen. Im Herbst 1941 sollte ich zur Schule gehen, aber der Unterricht fiel aus. So irrte ich ziellos durch die Straßen, weil meine Mutter beschäftigt war und so kam ich zum ersten Mal zu einer Barrikade. Später ging ich oft dorthin.
Einmal sah ich einen Toten, der in ein Leichentuch eingewickelt war. Ich war geschockt, dann gewöhnte ich mich aber daran, dass Tote auf Schlitten gefahren wurden oder oft auf der Straße lagen. Die kleinen Parks oder Gartenanlagen waren voll von ihnen, vor allem im Winter. Ich erinnere mich an einen kleinen Park an der Ecke unserer Straße, wo Tote in Leichentüchern gehüllt lagen, weil die Menschen keine Möglichkeit hatten, sie auf den Friedhof zu bringen.
Ich hatte keine Angst vor dem Beschuss, daran war ich gewöhnt, aber es gab noch eine andere Gefahr: Es gab Gerüchte, dass es Fälle von Kannibalismus an Kindern gab. Alle Hunde, Katzen und Mäuse in der Stadt waren bereits aufgegessen. Aber Gott war mir gnädig und dank der Sojamilch konnten wir auch meine kleine Schwester retten.
Als der Frost begann, fingen alle an, mit Öfen zu heizen, ab dem Moment gab es viele Brände. Ich ging auch oft zum Fluss Fontanka in unserer Nähe, um das Wasser zu holen. Es wurde Eimer auf Schlitten befestigt und Wasser aus dem Fluss geschöpft.
Es gab keine andere Möglichkeit, denn die Wasserversorgung funktionierte nicht. Das Schwierigste war, das Wasser auf dem Schlitten auf dem Weg nicht zu verschütten.
“Es kursierten Gerüchte von Kannibalismus.“
„Ich erinnere mich vor allem an den Hunger“
Ich erinnere mich, dass unser fünfstöckiges Haus fast ausgestorben war. Viele Leute, die ich gekannt und erst am Vortag noch gesehen hatte, waren am nächsten Tag nicht mehr da. Auch unsere Wohnung wurde leer. Mein Onkel wurde mit der Kirow-Fabrik evakuiert. Andere Verwandte verhungerten. Wir blieben in diesen sechs Zimmern allein.
Der Winter 1941/42 war der schlimmste. Tausende und Abertausende von Menschen starben in diesem Winter. Im Frühjahr erholten sich die Menschen ein wenig, es wurde grün, wir begannen Brennnesseln zu sammeln, aßen das alles, kochten daraus Suppen. Im Frühling fuhren die ersten Straßenbahnen, es hat mich in Staunen versetzt.
Während des Krieges bin ich sehr schnell erwachsen geworden, ich fühlte mich auch wie ein Erwachsener. Vor allem, weil niemand mir sagte, was zu tun war, da meine Eltern und ich auf uns allein gestellt waren. Ich musste mich auch um meine Schwester kümmern und hatte daher eine Menge Verantwortung.
Das versunkene Boot
Im Sommer wurde die Evakuierungsroute per Schiff über den Ladoga-See eröffnet. Wir beschlossen, dass wir einen zweiten Winter dieser Art nicht überstehen würden und trugen uns in die Evakuierungsliste ein. Ende Juli 1942 packten wir das Nötigste ein, eine Menge Sachen kamen aber trotzdem zusammen.
Zuerst wurden wir mit dem Zug zur Station Ladoga-See gebracht. Heute ist diese Strecke kurz, aber damals dauerte es viele Stunden bis wir dort ankamen. Wir kommen also dort an und da bietet sich uns ein erschütterndes Bild: Die Leute sitzen mit ihrem Gepäck am Ufer und warten auf das Schiff, das sie über den Ladoga-See bringen soll, aber der See wird gerade von deutschen Fliegern bombardiert.
Wir hatten unser Gepäck separat nach Ladoga geschickt. Meine Mutter hatte einen der Säcke irgendwie zu spät angemeldet, sodass wir vor Ort auf ihn warten mussten, denn da drin waren unsere ganze Wäsche und andere wichtige Dinge. Deshalb mussten wir das nächste Schiff nehmen. Und da gab es einen Luftangriff und das erste Schiff, auf dem wir hätten mitkommen sollen, ging unter. Ein Glücksfall, das uns Leben schenkte.
“Die Wohnung wurde leer – einige evakuiert, andere gestorben.“
Ich erinnere mich noch an die antisowjetischen und antisemitischen Stimmungen während der Blockade. Einmal sagte mir ein Junge auf der Straße: „Wenn die Deutschen kommen, werden sie euch Juden töten und jeder von uns kriegt eine Kuh.“ Das war ein Junge aus den dörflichen Gebieten, der während des Krieges nach Leningrad geflohen war. Sein Traum war eine Kuh. Die Deutschen warfen tatsächlich Flugblätter ab, auf denen stand, dass sie allen eine Kuh schenken würden. Eine Kuh schien damals etwas absolut Unwahrscheinliches zu sein, nachdem sogar alle Mäuse aufgegessen waren…